ZWISCHENRUF: „Diskriminierung ist auch dort allgegenwärtig, wo wir sie nicht vermuten“
Dennis Chiponda engagiert sich in diversen Projekten gegen Intoleranz und für eine vielfältige Gesellschaft. Im Interview erzählt er, wie man mit dem eigenen Hass umgehen kann, warum wir zu viel Angst vor Verlust haben und warum Konflikte ein gutes Zeichen sind.
Herr Chiponda, warum tun sich viele Menschen schwer, mit Vielfalt zu leben?
Dennis Chiponda: Grundsätzlich besitzt der Mensch erstaunliche Beharrungskräfte. Alle spüren gerade, dass sich die Welt verändert – wachsende Ungleichheit, Klimawandel, Migration – bei vielen löst das Angst aus. Angst vor dem Verlust von Sicherheit, von Wohlstand. Erschwerend kommt hinzu, dass die schon während des Kolonialismus‘ erlernten diskriminierenden Formen nie wirklich aufgearbeitet wurden. Der Druck, sich hierzulande der Mehrheitsgesellschaft anzupassen, ist noch immer enorm.
Sie selbst haben Kindheit und Jugend im Nachwende-Brandenburg verbracht, dann Ostdeutschland den Rücken gekehrt und wohnen jetzt in Leipzig. Wie kam es, dass Sie „Rückkehrer“ wurden?
Ich habe erst im Ausland gelernt, wie deutsch ich bin, und in Bayern habe ich erlebt, wie ostdeutsch ich bin. Vorher hatte ich das nie wahrgenommen, weil mir immer vermittelt wurde, dass ich gerade nicht dazugehöre. In Westdeutschland habe ich dann gemerkt, wie sehr die eigene Lebensrealität das Denken dominiert. An diesem Punkt unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche tatsächlich stark. Ich bin dann zurückgekehrt, weil ich mich dort engagieren wollte, wo ich die Leute verstehe. Ich komme mit der Mentalität in Ostdeutschland einfach besser klar.
Was sind Ihre Alltagserfahrungen als Schwarzer Deutscher, der in Leipzig wohnt?
Leipzig ist eine Insel innerhalb Sachsens. Im Alltag begegnet mir selten Rechtsextremismus, ich brauche keine Angst vor Gewalt zu haben. Aber Diskriminierung ist allgegenwärtig – und zwar auch in linken Parteien oder Stiftungen, mit denen ich zusammenarbeite – also dort, wo man es nicht vermuten würde. Wir sind nun einmal rassistisch sozialisiert und müssen erst lernen, Menschen nicht zu verletzen. Ich nehme mich da selbst überhaupt nicht aus, wenn es zum Beispiel um Sensibilität gegenüber Genderfragen geht oder Menschen mit Behinderung. Wir haben Hass in uns, und wir müssen lernen, mit ihm umzugehen. Wenn man das erst einmal erkennt und akzeptiert, dann kann daraus sehr schnell etwas Positives entstehen.
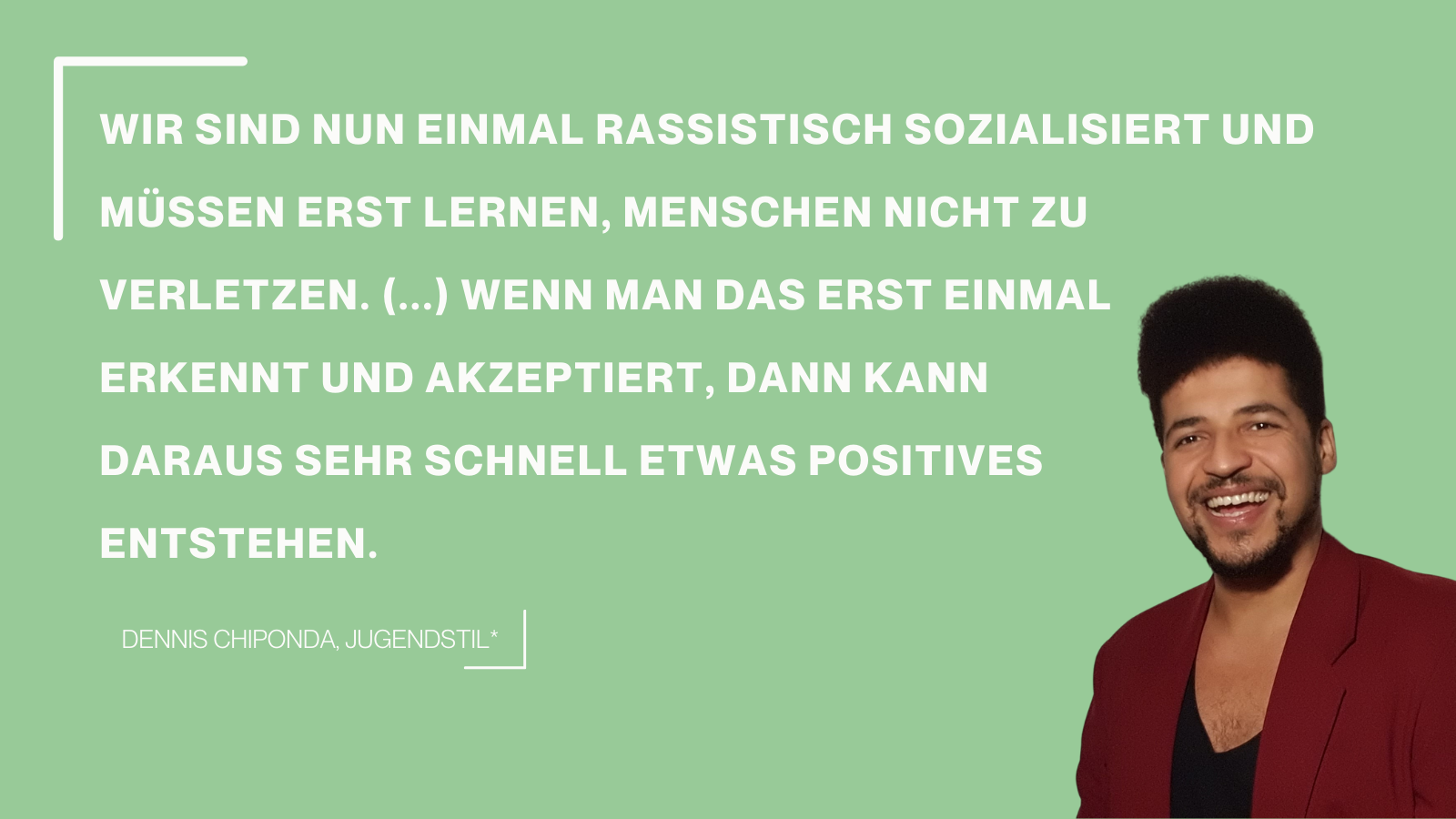
Wie sehr macht es Sinn, Rechtsextremismus und speziell Rassismus zum vorrangig ostdeutschen Phänomen zu erklären?
Viele Leute meinen – 30 Jahre nach dem Mauerfall: „Dieses Ost-West-Denken muss doch mal aufhören!“ Sie sehen nicht, dass der Westen zur dominanten Norm wurde. Uns Ostdeutschen wurde das übergestülpt. Es gibt gewaltige Unterschiede in den Erfahrungen, und es gibt im Osten sicher weniger Bezugspunkte zu anderen Lebensweisen. Rechtsextremismus ist aber in Ost und West verankert.
Es gibt viele Ansatzpunkte, um Intoleranz entgegenzutreten. Wo engagieren Sie sich?
Mein ganzes ehrenamtliches Tun ist von einem Gedanken geprägt: Ich mache Politik und engagiere mich für ein demokratisches Zusammenleben. Das mache ich bei der SPD, bei der Initiative „Leipzig spricht“ und in vielen anderen Projekten. Mich treibt um, wie wir gut zusammenleben können und wie wir Empathie für andere Lebensentwürfe entwickeln können. Die Mehrheitsgesellschaft muss keine Angst davor haben, etwas zu verlieren, wenn man marginalisierte Gruppen stärkt. Im Gegenteil! Dann gewinnen alle.
Besonders wichtig ist es mir, jungen ausgegrenzten Menschen zu zeigen, dass man es auch in dieser Gesellschaft schaffen kann, dass man sich gegen das Narrativ der Mehrheit durchsetzen kann. Da ist so viel Potenzial, das nicht genutzt wird – Empowerment ist der Schlüssel, um es zu heben.
Was muss sich auch innerhalb der Zivilgesellschaft ändern?
Beispielsweise der Bereich Förderung: Ganz viele Anträge sind so gestaltet, dass jemand bildungsfernes oder mit migrantischen Wurzeln abgeschreckt ist. Das muss niedrigschwelliger werden und nicht so sehr den starren Verwaltungslogiken folgen. Essenziell ist, dass in den Institutionen – sei es in einer Behörde oder einer Stiftung – auch beispielsweise People of Color arbeiten. Repräsentation ist hier gefragt.
Wie sieht Ihre Zukunftsprognose aus?
Wir sind noch am Anfang. Aber es tut sich etwas. Ich bin ein starker Verfechter des Integrationsparadoxons, das besagt: Wenn mehr Gruppen teilhaben, muss erst einmal neu ausgehandelt werden, wie man gut zusammenleben kann. Das erzeugt auch Konflikte, später ist dann ein Miteinander auf Augenhöhe möglich.
Dennis Chiponda wuchs in einer Kleinstadt in Brandenburg auf. Nach vielen Stationen im In- und Ausland lebt der umtriebige Tänzer und Politikstudent nun in Leipzig und engagiert sich unter anderem für die Initiative „Leipzig spricht“, die Jury des Programms JUGENDSTIL* und die SPD.
